|
|
|
Die Leinenweberei bis ins 19.
Jahrhundert |
Die bäuerliche Leinenweberei
Schon in vorgeschichtlicher Zeit war die
Leinenweberei in ganz Mitteleuropa ein fester
Bestandteil der bäuerlichen Produktion. Auf jedem Hof
wurde gewebt, Leinenstoffe gehörten auch zu den
Fronabgaben der abhängigen Bauern an ihren Lehnsherrn.
Zunächst war die Flachsverarbeitung ausschließlich die
Aufgabe von Frauen und man kann davon ausgehen, daß
Spinnen und Weben seit jeher zum allgemeinen Wissen
jedes Mädchens, jeder Frau gehörte
Die Verarbeitung von Flachs bis
zum Gewebe blieb mit der ländlichen Bevölkerung
verbunden wie kein anderes textiles Material. Ein
großer Teil der Flachsfasern wurde bis ins 19.
Jahrhundert von der ländlichen Bevölkerung versponnen
und verwebt. Auch die erwerbsmäßig betriebene
Leinweberei war zum größten Teil auf dem Lande
angesiedelt.
Der Anbau von Flachs ist
Landarbeit, seine Bearbeitung bis zur verspinnbaren
Faser war und ist die Arbeit des Landwirtes. Jeder
Bauer, auch die Kleinbauern, pflanzten ehemals Flachs
an, zumindest für den eigenen Bedarf. Man spann und
webte das Leinen selbst. Möglichst viele Ballen gut
gewebter, hochwertiger Leinenstoffe zu besitzen,
gehörte zum Imagebewußtsein der bäuerlichen
Bevölkerung noch bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Deshalb war die Spinnerei und Weberei nicht nur ein
großer und wichtiger Arbeitsbereich, es war einer der
wichtigsten Maßstäbe für das Selbstwertgefühl der
Landfrauen.
In verschiedenen Regionen wurde
über den Eigenbedarf hinaus auch für den Verkauf
produziert. Sowohl der gehechelte Flachs als auch das
gesponnene Garn und der Leinenstoff waren eine
begehrte Handelsware.
Alle Arbeiten waren stark
ritualisiert. Das galt für alle Bereiche der
Flachsverarbeitung, doch unterschieden sich die
Bräuche und Gepflogenheiten sehr in den verschiedenen
Landesteilen Deutschlands.
Man begann an bestimmten Tagen
des Jahres mit bestimmten Arbeiten, die jeweils von
bestimmten Leuten ausgeführt wurden. So sollte nach
altem Brauch am 100sten Tage im Jahr der Bauer den
Flachs säen. Jäten war die Arbeit von den Mägden und
Töchtern des Hofes. Das Ausraufen der Flachsstengel
war ebenfalls Sache der Frauen und mit Bräuchen
verbunden, wobei die Mägde dieses eine mal im Jahr
ihre Wichtigkeit am Hof dokumentieren durften. So
mußte sich z.B. der Bauer in niedersächsischen Dörfern
von den Mägden mit Flachs fesselt lassen und dann mit
spendiertem Schnaps wieder loskaufen.
Die Bearbeitung des Flachses bis
zum fertigen Faden war in früheren Jahren im
wesentlichen Frauensache, es war sozusagen ihr
wichtigstes Metier. Zur Aussteuer jedes Mädchens
gehörten die dazu notwendigen Geräte, die Breche, die
Schwinge, die Hechel, sowie das Spinnrad und der
Haspel. Der Umgang mit diesen Geräten, vor allem das
Spinnen, gehörte lange zum selbstverständlichen Wissen
jedes Mädchens. Später beteiligten sich auch Männer an
der Arbeit, vor allem in den Regionen, wo die
Leinenweberei zum wichtigen Erwerbszweig geworden war.
Das Flachsreffen in der Scheune,
die Arbeit um das Rotten, Trocknen, Rösten , Brechen
und Schwingen war in den meisten Dörfern eine
Gemeinschaftsarbeit aller weiblichen Mitglieder eines
Hofes, die sie im Herbst bei geeignetem Wetter in
Freien ausführten. In den kleineren Höfen taten sich
auch die Nachbarinnen zusammen und half sich
gegenseitig. Das Brechen des Flachses und das
Schwingen, d.h. Abschlagen der Stengelsplitter, der
Schäben, war Schwerarbeit, die man sich mit Singen und
Scherzen zu erleichtern suchte. Ein gutes Essen,
zubereitet von der Bäuerin, war den Arbeiterinnen
gewiß.
Der grob gehechelte Flachs
lagerte dann, zu kleinen Docken oder Bündeln gedreht,
bis zur weiteren Verarbeitung. Mancher „Kloben“ oder
„Stein“ - eine bestimmte Menge dieser Flachsdocken -
kam auch auf den Markt zum Verkauf oder wurde von
reisenden Händlern aufgekauft.
Das Spinnen von Flachs und Werg
war die umfangreichste Arbeit im ganzen Prozeß. Meist
an Martini begannen alle weiblichen Mitglieder der
Höfe damit, jeden Abend spinnend zu verbringen. Es war
ein bestimmtes Quantum pro Woche zu leisten, das sich
nach den Gegebenheiten richtete. Die Leistung, die
erbracht werden mußte, vorgegeben von der bäuerlichen
Herrschaft, war groß und nur bei permanentem Fleiß zu
schaffen. Da es sich um eine eintönige Arbeit
handelte, die Geselligkeit leichter zu bewältigen war,
entstanden allerorts Spinnstuben, die vor allem von
den jungen Leuten frequentiert wurden. Diese
Spinnstuben waren seit alters her die Zentren für
Kommunikation bei der ländlichen Bevölkerung .
Mädchen einer Altersgruppe trafen
sich reihum im Hause eines der Mädchens, um zusammen
zu arbeiten, zu singen und zu lachen. Zu den
Mädchengruppen im heiratsfähigen Alter gesellten sich
auch Burschen und man verbrachte fleißige und doch
heitere Abende miteinander. Doch gesponnen wurde nicht
nur in den Spinnstuben. Auf großen Höfen blieben
Bäuerin, Töchter und Mägde auch im Hause, ältere
Frauen spannen manchmal auch den ganzen Tag. Spinnen
war die Arbeit, die selbst von gebrechlichen Menschen
geleistet werden konnte und getan werden mußte. Alle
weiblichen Mitglieder einer Hofgemeinschaft
konnten spinnen und mußten dies auch, sonst wäre die
notwendige Leistung nicht zu erbringen gewesen. Das
gilt wohl für ganz Deutschland.
Meist Anfang Februar, an Lichtmeß
(2. Februar), begann die Webarbeit. Der Webstuhl wurde
dann aus der Scheune geholt und in der Wohnstube
aufgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte der meiste
Flachs versponnen sein und die Bäuerin begann mit der
Planung, was davon in diesem Jahr verwebt werden
sollte, was gebraucht wurde und für welche Art Stoff
genug Garn vorhanden war, denn es wurden viele Kilos
jeder Sorte für eine Kette von 100 m Länge und mehr
gebraucht.
Wer sich an den Webstuhl setzte,
war in den einzelnen Landstrichen Deutschlands sehr
verschieden. Im Norden Deutschlands waren es nach wie
vor die Frauen, die auch diese Arbeit übernahmen.
Heinrich Paulsen (geb. 1846) berichtet über die
Verhältnisse in den Dörfern von Schleswig:
„Wie
die Ernährung, so wurde auch die Kleidung in der
Hauptsache mit den eigenen Mitteln und den Künsten des
Haushalts bestritten... Webstühle waren in vielen
Häusern, so im Elternhaus des Vaters wie der Mutter,
nicht in unserem; es fehlte an Zeit und auch an Raum
dafür. Dagegen waren die Spinnräder im Winter wohl in
jedem Haus in schnurrender Bewegung; Nachmittags und
abends saßen die Mutter und das Mädchen regelmäßig am
Spinnrad...
Wie
die Kleidung, so war auch die Wäsche Erzeugnis des
Hausfleißes. Die Mutter kaufte jeden Herbst einen
„Stein“ Flachs in Bredstedt ein. Er wurde von ihr
eigenhändig gehechelt, erst durch grobe, dann durch
feinere Kämme von Eisenstacheln gezogen und so von der
Hede (Werg) gesondert, in zierliche Bündlein
aufgeknüpft und dann versponnen. Die Leinwand, die sie
aus dem Garn von einer Nachbarin weben ließ, wurde auf
der Wiese gebleicht und dann zu Hemden, Bettlaken,
Handtüchern, Tischtüchern und Überkleidung
verarbeitet...“
In Hessen, Westfalen, Franken, im
südlichen Deutschland webten in der Regel die Männer
auch in der bäuerlichen Weberei. Auch in diesen
Ländern stand auf fast jedem Hof ein Webstuhl, wurde
Flachsanbau und Bearbeitung betrieben, in einigen
Regionen nicht nur für den eigenen Bedarf. Den Bauern
war es in der Regel nicht erlaubt, die Wolle ihrer
Schafe zu verweben. Ausgenommen war „Beiderwand“ für
den eigenen Gebrauch. Das war ein Stoff mit Leinen in
der Kette und Wolle im Schuß, gewebt in
Leinwandbindung, den die bäuerliche Bevölkerung für
Jacken und Röcke verwendeten.
Alles, was die Bauern an
Leinenstoffen, auch Garn oder Flachs, nicht für sich
selbst gebrauchten, wurde verkauft. In einigen
Regionen war das mehr, anderswo weniger oder auch
nichts. Der Verkauf erfolgte über Händler, die den
Stoff im Ballen, also unzerschnitten, aufkauften und
überregional, oft im Export, vermarkteten.
„Das
einzige Verdienst, was die Leute dort hatten, bestand
darin, daß sie im Sommer Flachs zogen, diesen zu Garn
spannen, das Garn zu Leinwand verwebten - in jedem
Haus stand ein Webstuhl - und die Leinwand nach
Arolsen verkauften...“ (Auszug aus: Peter Lübke,
Lebenserinnerungen)
Gab es eine Konzentration von
Leinenweberei in einem Gebiet, so waren meist auch die
Einrichtungen zur Flachsbearbeitung in größeren
Anlagen im Dorf vorhanden. Reste dieser Einrichtungen
kann man gelegentlich heute noch finden,
beispielsweise um Frechen am Niederrhein. Die
Wassertümpel zum Rotten des Flachses oder die
Darrhäuser zum Trocknen der Halme vor dem Brechen und
die Bleichwiesen mußten von den Gemeinden zur
Verfügung gestellt werden durften von allen, die
dieses Gewerbe betrieben, genutzt werden. Wie und in
welcher Reihenfolge, war mit Vorschriften genau
geregelt.
„Alle
Flachs- und Hanfarbeit soll nicht in Städten, Flecken
oder Dörfern, oder in Häusern, sondern außerhalb
geschehen, an Orten, wo man Feuers halben gesichert
und wo kein Brand zu befahren ist.“
(Nassauisches
Gesetz von 1599) |
Die gewerbliche Leinenweberei |
|
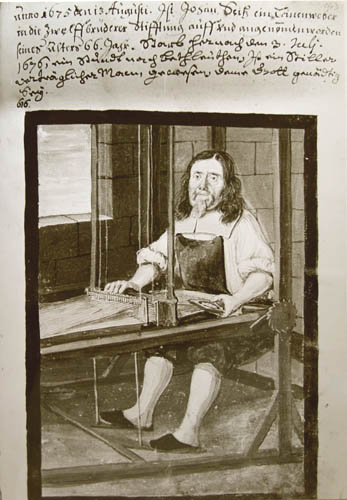 |
|
Leinenweber 1676, Landauersche Stiftung
Nürnberg, Stadtbibliothek Nürnberg |
|
Damit sind wir bei der gewerblichen Leinenweberei
angelangt. Im Laufe des Mittelalters bildete sich
neben der bäuerlichen Weberei ein Handwerksstand in
diesem Metier sowohl in den Städten wie auf dem Land.
Doch der städtische Leinweber blieb in der Minderheit,
Vereinigung zu Zünften waren eher die Ausnahme, denn
Leinen wurde auch weiterhin vornehmlich auf dem Lande
von der bäuerlichen Bevölkerung verarbeitet.
Der Leinwand webende Bauer und
der Ackerbau betreibende Leinweber ist im Rückblick
oft nur schwer zu unterscheiden, denn die Handweber
betrieben meistens auch etwas Landwirtschaft. Der
Unterschied lag in den technischen Webkenntnissen, die
der Leinweber besaß, während die bäuerlichen Familien
im wesentlichen das einfache Haustuch in
Leinwandbindung herstellte, wovon es allerdings den
größten Bedarf gab.
Schon im Laufe des 16. und verstärkt im 17.
Jahrhundert entwickelte sich die Leinenweberei in
einigen Regionen zum wichtigen Nebenerwerb; und,
herrschten günstige Bedingungen für den Flachsanbau,
auch zum wichtigsten Gewerbe, in das der größte Teil
der Bevölkerung integriert war. Es entstanden
Webzentren, wo nicht mehr nur für den regionalen
Verbrauch produziert wurde, sondern im wesentlichen
für den Exporthandel, der von den Städten aus
organisiert wurde. Beispiele dafür sind die
Textilgebiete am Niederrhein um Aachen, Wuppertal,
Krefeld und Köln, die sich bis in die Eifel
zogen. Auch in Osthessen, im südlichen Niedersachsen
oder im bayrischen Wald breitete sich die Leinweberei
aus. Wichtige Gebiete für die gesamte
Textilherstellung waren Brandenburg um Berlin oder die
Oberlausitz in Sachsen, später auch Oberschlesien, wo
das Leinengewerbe bis weit ins 19. Jahrh. einen großen
Platz einnahm. Doch auch im Süden Deutschlands gab es
Gebiete, wo der Flachsanbau und die Leinenweberei
zunächst eine große Rolle spielten.
|
|
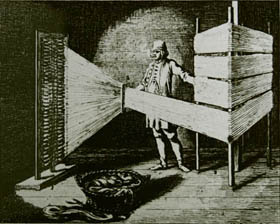 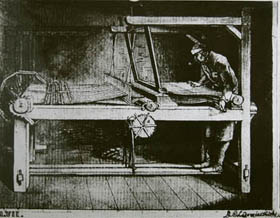 |
|
Die Kette wird geschärt, Zeichnung von Chodowiecki
zu Badows Elementarwerk 1770
|
Der Weber, Zeichnung von Chodowiecki
zu Badows Elementarwerk 1770 |
| Von ihrer
Entwicklung und der Struktur her unterschieden sich
die einzelnen Webzentren deutlich, gemeinsamer Nenner
war der überregionalen Handel, der von sog.
"Verlegern", den dazu privilegierten Händlern,
organisiert wurde. In einigen Regionen wie z.B. in
Niedersachsen, Hessen oder dem bayrischen Wald konnten
die Leinweber bzw. Bauern ihre Selbständigkeit sehr
lange erhalten, in anderen Regionen wie Berlin,
Sachsen, Schlesien oder am Niederrhein, den
wichtigsten und größten Textilgebieten Deutschlands,
war das nicht der Fall. Immer mehr der in diesem
Metier arbeitenden Menschen waren ohne eigenes Land
und verloren ihre Eigenständigkeit, kamen in
Abhängigkeit von städtischen Kaufleuten. Die
Entwicklung der Weberei in den einzelnen Gebieten
bedürfen einer eigenen Darstellung, hier nur kurz ein
paar kurze Beispiele im Überblick.
Als im 16. Jahrhundert der Wohlstand stieg und
damit Bedarf an Textilien wuchs, entwickelte sich eine
industrielle Handweberei, oder Hausweberei. Der
Verkauf der Stoffe wurde von Händlern organisiert. Das
Privileg dazu hatten sich Patrizier und Ratsherren
gesichert, welche die Stoffballen von den Webern
aufkauften und weiter vermarkteten. Zunächst wurde der
Flachs aus dem örtlichen Anbau verarbeitet, doch als
das nicht mehr reichte, mußte Flachs - als Rohmaterial
oder Garn - eingeführt werden. Das geschah vornehmlich
ebenfalls durch die Handelsherren, die für den Einkauf
Aufkäufer durch andere Regionen Deutschlands
schickten. Zur Finanzierung des Materials gehörte
Kapital, das die meisten Weber nicht besaßen. So kam
der Handel bald in die Hände von wenigen großen
Kaufleuten. Die Weberfamilien - in der Heimweberei
waren immer alle Familienmitglieder integriert -
verarbeiteten das vom Verleger gelieferte Material.
Sie verloren damit ihre Selbständigkeit und wurden zu
Verlagsarbeitern, abhängig von "ihrem" Verleger. So
entstand "industrielle" Weberei, obwohl nach wie vor
alles reine Handarbeit war. Industriell, weil eine
bestimmte Ware in Mengen produziert wurde, wobei der
Prozeß der Herstellungnicht mehr in einer Hand
verblieb wie das beim Handwerk der Fall war.
Der Niederrhein stand stark unter dem Einfluß der
Niederlande, die in der Weberei Europas Vorreiter
waren. In Flandern gab (und gibt es heute noch) große
Anbaugebiete für Flachs, gab es sehr gut ausgebildete
Weber, die auf Grund politischer Unruhen von dort weg
in Richtung Osten auswanderten und die Weberei
Deutschlands sehr wesentlich beeinflußten.
Am Niederrhein entstanden Zentren in Aachen, Wuppertal
und Köln - um die wichtigsten zu nennen - von wo aus
einige Patrizier, dann Verleger, die Produktion der
Leinenstoffe auf dem Land rundherum - von Köln aus bis
in die Eifel - leiteten. Die Leinenweberei kam dort zu
großer Blüte, von Mitte des 17. bis Ende des 18.
Jahrhunderts entstanden dort neben der Massenware in
feinster Ausführung zudem sehr hochwertige Damaste -
Tafeltücher - aus Leinen mit großflächigen
Bildentwürfen.
|
Ähnlich wie
am Niederrhein waren die Verhältnisse in der
Oberlausitz. Im schlesischen Gebirge, wo Friedrich der
Große sächsische Weber ansiedelte, entwickelte sich
von Anbeginn eine verlagsmäßig betriebene
Leinenweberei mit einem Höhepunkt gegen Ende des 18.
Jahrhunderts. Das schlesischen Leinen gehörte wie auch
das sächsische, zu den hochwertigen Produkten
Deutschlands. Trotzdem waren die meisten Weberfamilien
dieser Region keine selbständigen Handwerker mehr und
abhängig vom Verleger.
|
 |
 |
|
Leinenhandtuch, Halbdamast |
Damastgewebe aus Leinen, blau/weiß
„Verkündigung“ gewebt Schlesien um 1700, Nürnberg,
Germanisches Nationalmuseum
|
| Anders waren
die Verhältnisse im Vogelsberg in Osthessen oder im
Ravensberger Land um Bielefeld, wo Leinenweberei
ebenfalls ein wichtiger Erwerbszweig geworden war.
Auch hier lernte man zu Leinengewebe mit Mustern zu
verzieren, doch war alles ein wenig derber und
einfacher. Hier arbeiteten Handwerker und Bauern auf
eigene Rechnung bis zum fertigen Stoff, dann
verkauften sie diesen an einen der Aufkäufer, die im
Auftrag eines Verlegers über Land reisten.
Um einen hohen und gleichbleibenden
Qualitätsstandart für die Leinenstoffe zu erhalten,
wurden Prüfstellen in den Städten eingerichtet, die "Legge"
wohin die Bauern und Leinweber ihre fertige Ware
bringen mußten. Jeder Stoffballen, der nicht für den
Eigenverbrauch gedacht war, mußte "beschaut" und
gesiegelt werden. Ein amtlich bestellter Leggemeister
prüfte den Stoff auf Länge, Breite, Fadendichte
Webqualität und Fehlerfreiheit. Der Stoff wurde auf
dem "Leggetisch", ausgelegt, so daß alle Unebenheiten
genau kontrolliert werden konnten. War alles in
Ordnung, bekam der Stoff ein Gütesiegel. Kein Stoff
durfte ohne dieses Gütesiegel zum Verkauf kommen.
Wurden die geforderten Kriterien nicht erreicht,
schnitt der Leggemeister den Stoff auseinander, damit
gewährleistet war, daß diese Stücke für einen Verkauf
nicht mehr in Frage kommen konnten. Bei Lohnarbeit für
einen Verleger wie z.B. in Schlesien, übernahmen auch
"Faktoreien" diese Kontrolle. (Faktoreien waren die
Niederlassungen großer Verleger in kleineren Städten,
von wo aus Materialausgabe und Warenablieferung
abgewickelt wurden.) Entsprach die abgelieferte Ware
in der Qualität nicht den Wünschen des Auftraggebers,
so war man nicht zimperlich mit den Strafen. Später
wurden diese Güteprüfungen auch zum probaten Mittel,
die Entlohnung für die Arbeit der Weber immer weiter
zu drücken.
Der Handel mit den Stoffen wurde, wie bereits
erwähnt, in den Städten organisiert; von nur wenigen
großen Kaufleuten, Patriziern oder Ratsherren, die
sich das Recht zum Großhandel gesichert hatten. Die
Bauern und Leinweber dieser Regionen besaßen in der
Regel keine Konzession, einen Handel mit ihren Stoffen
zu betreiben. In großen städtischen Lagerhäusern (in
Köln stehen sie noch), auch in den Messestädten
Leipzig und Frankfurt, wurden die Waren gelagert und
dann während der verschiedenen jährlichen Messen an
die kleineren Händler vermarktet. Der Export spielte
schon seit dem 17. Jahrhundert eine große Rolle. Dabei
war das westliche Deutschland nach Amsterdam,
wichtigster Drehpunkt im Überseehandel, orientiert,
Ostdeutschland mehr nach Nord- und Osteuropa; Rußland
war Schlesiens wichtigster Handelspartner.
Durch die Konzentration der Leinenweberei entwickelte
sich dann jeweils ein sehr hoher Standart an Qualität
der Stoffe, wodurch die Waren begehrt und gut
verkäuflich wurden. Die viele Arbeit brachte Wohlstand
für viele Menschen in diesen Regionen, doch
gleichzeitig auch eine starke Krisenanfälligkeit.
Krisen gab es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder.
Vor allem jeder politische Umschwung brachte dann
Probleme für die ganze Bevölkerung, da die meisten bei
der Weberei integriert waren. So ist zu erklären, daß
gerade hier, in Regionen mit guter wirtschaftlicher
Grundlage, immer mehr Menschen ihre Eigenständigkeit
verloren und in die Abhängigkeit von Kaufleuten und
Verlegern gerieten.
|
|
Die handwerkliche Leinenweberei
|
Völlig unberührt vom Aufschwung und der Konzentration
von Leinenweberei in den verschiedenen Zentren
entwickelte sich das Leinengewerbe auch in Regionen
Deutschlands, wo ausschließlich für den örtlichen
Bedarf gearbeitet wurde. Hier waren die Handwerker in
der Regel selbständig und in direktem Kontakt zu ihren
Kunden. Sehr häufig verarbeiteten sie das Material des
Kunden nach deren Wünschen.
Der Stand der städtischen Leinweber war schwierig.
Häufig galt die Leinenweberei als nicht zunftsfähig.
Konnten die Leinweber dann trotzdem eine
Zunftvereinigung durchsetzen, gab es immer Probleme
mit den wesentlich einheimischen Tuchmachern. Man
stellte die Leinweber in eine Reihe mit den
Totengräbern, den Scharfrichtern oder Nachtwächtern
und anderen Berufen, die als "unehrlich", gemeint ist
unehrenhaft, galten.
Diese Ächtung brachte viele Nachteile: Die Familien
mußten z.B. in bestimmten Stadtbezirken wohnen, einem
Leinwebersohn war es nicht erlaubt, Tuchmacher zu
werden oder einen anderen "zünftigen" Beruf zu
erlernen. Ließ ein Tuchmacher einen Leinweberknecht
für sich arbeiten, erwarteten ihn Sanktionen von
Seiten seiner Zunft. Für die Leinweber gab es deshalb
kaum Möglichkeiten, aus ihrem Lebenskreis
auszubrechen. Das technische Wissen wurde von einer
Generation zur nächsten weitergegeben, eine andere
Chance gab es nicht.
Heute läßt sich nicht mehr nachprüfen, worauf der
schlechte Leumund der Leinweber basierte. In vielen
Vorschriften sind Prüfungen und schwere Strafen für
schlecht oder falsch gewebte Stoffe festgelegt, auch
sind einzelne Protokolle von Strafverfahren vorhanden,
doch eine schlüssige Erklärung für das üble Image
dieses Berufsstandes findet sich nicht. Belegt ist,
daß die städtischen Leinweber zur armen
Bevölkerungsschicht gehörten.
Sie waren in der Minderheit gegenüber den Tuchmachern
und auch den Dorfwebern. Mit dem größer werden der
Webzentren und dem damit verbundenen Stoffhandel gab
es schon im Laufe des 18. Jahrhunderts immer weniger
Existenzmöglichkeiten für diese Handwerker in den
Städten.
Anders auf dem Dorf, wo die Leinenweberei sehr
häufig ihre Bedeutung bis gegen Ende des 19.
Jahrhunderts behielt. Die dörflichen Handwerker
stellten im wesentlichen jene Leinenstoffe her, die
von den Bauern oder Bäuerinnen nicht gewebt werden
konnten. Das gilt auch für Norddeutschland. Man liebte
zum Beispiel für Handtücher und Tischdecken Muster mit
Würfelköper, doch dies zu Weben bedingte ein
technisches Wissen, das nur die Leinweber hatten. Es
gab auch Leute, die keine Möglichkeit zum Weben
besaßen, kein Gerät, kein Wissen oder nicht genug
Material auf einmal, sie ließen den Leinweber für sich
arbeiten. Es gab auch beides gleichzeitig, d.h. auf
einem Hof wurde gewebt, doch weil die Fertigstellung
einer Aussteuer anstand und man allein nicht mit der
Arbeit fertig wurde, gab man einen Teil in Auftrag
oder ließ den Leinweber kommen, der half.
In welcher Form die Aufträge vergeben wurden, dafür
gab es unterschiedliche Traditionen in Deutschland.
Mancherorts brachte man dem Weber das gesponnene
Material und er verwebte das Garn im Stücklohn nach
Wunsch und Anweisung. Anderswo bestellte man den Weber
für bestimmte Arbeiten wie das Schären und Aufziehen
einer Kette auf den Webstuhl ins Haus, weil viele
Bauernfamilien diese Arbeit nicht ausführen konnten.
Das war z.B. in vielen Orten Hessens der Fall.
Andererseits kamen die Leinweber auch für die gesamte
Webarbeit ins Haus. In Oberbayern z.B. war es üblich,
daß die Dorfweber "auf die Stör" gingen.
Die Störarbeit ist die älteste Form des Handwerks.
Hierbei kommt der Handwerker zur Arbeit ins Haus des
Auftraggebers. Die Arbeitsgeräte stehen ihm dort
entweder zur Verfügung (die ältere Form) oder er
bringt sie mit, was später zur Regel wurde. Ist alle
Arbeit in diesem Haus beendet, zieht der Handwerker
mit den Gerätschaften zum nächsten Bauernhof, um dort
den nächsten Auftrag zu erledigen.
In allen Fällen handelt es sich um selbständige
Handwerker mit einem festen Kundenkreis und mit einer,
von ihm selbst mit dem Kunden verhandelten und
festgelegten Entlohnung. Die Leinweber auf dem Lande
besaßen zudem eine kleine Landwirtschaft, manchmal
auch die Möglichkeit, im kleinen Rahmen Stoffe auf
eigene Rechnung für den örtlichen Bedarf herzustellen.
Die besser gestellten Leinweber ließen auch
"Weberknechte", Gesellen, für sich arbeiten. Sehr
häufig jedoch reichte die Webarbeit nicht über das
ganze Jahr. Vor allem die Weberknechte mußten sich im
Sommer in der Landwirtschaft verdingen, aber auch
manch ein selbständiger Leinweber war in dieser Lage,
weil die Aufträge nicht ausreichten. Häufig waren sie
die Ärmsten im Dorf, so geht es jedenfalls aus einem
Bericht von Wilhelm Keil (Erlebnisse eines
Sozialdemokraten) hervor:
|
|
Im Dorfe war zu jener Zeit
die Leinweberei noch ein sehr unentbehrlicher Beruf.
Viele Familien bauten und verarbeiteten ihren eigenen
Flachs. Auf dem eigenen Spinnrad ward der Faden
gedreht, die der Weber dann zu Leinwand wob. Auf dem
eigenen Rasen wurde das Tuch von der Sonne gebleicht,
um schließlich zu Hemden, Tisch- und Leintüchern
genäht zu werden. Wie wenig ertragreich indes der
Beruf des Leinwebers war, geht schon aus dem
Leinweberlied hervor, das von der anspruchslosen
Lebensweise dieser Zunft in sarkastischen Worten
singt. Kartoffeln, Mehrsuppe, ein Stück Brot, das war
die alltägliche Nahrung dieser Hungervirtuosen.
|
|
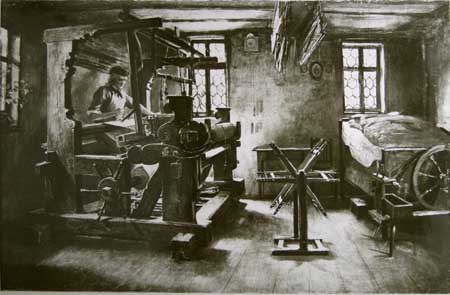 |
Um zu zeigen, wie tief die Weber mit ihrer
Tradition verbunden waren, trotz oft harter
Lebensweise, hier Auszüge aus einem Bericht aus dem
Umland von Marburg: "Georg, der letzte Dorfweber". Die
bäuerliche Leinenweberei war in dieser Gegend in der
alten Form erhalten geblieben. Um 1900, der Zeit, aus
der dieser Bericht erzählt, gab es noch drei Leinweber
im Dorf, einer davon war Georg Webers Onkel. |
|
"...Als Kinder mußten Georg
und seine Geschwister das Spulen übernehmen... er ging
noch in die Volksschule, da lernte er vom Vater
"einfach Leinen" weben und nach der Schulzeit brachte
ihm der Onkel die Handtuchmuster bei: "Wenn du's jetzt
nicht lernst, muß ich die Aufträge zurückgeben"...
Den ganzen Winter wurde gewebt, der Vater und Georg
lösten sich am Webstuhl ab: "Aber der Vater war gut
und ließ mich gerne mal laufen." Für eine Steige zu
100 Ellen gab es drei Mark und einen Laib Brot und es
war nicht immer leicht, das fertige Gewebe
fortzuschleppen: "aber gut Frühstück gab's allemal bei
den Bauern." Zwar wurde von den Frauen scharf nach
Webfehlern gesucht, doch war da nichts zu finden und
so unterblieb bei den alten Kunden die Musterung...
Der Vater begann in der Frühe gegen vier Uhr. Der Sohn
setzte sich um sechs an den Webstuhl und unermüdlich
klang der Anschlag bis abends zehn Uhr, 20 Ellen
wurden am Tag geschafft, "wenn alles gut ging". Doch
bei den Tischtüchern, die Georg nach einem alten
Musterbuch webte, ging es nicht so schnell wie bei den
bandstreifigen oder mit Karos gewebten Handtüchern."
Der Familienname dieser dörflichen Leinweber war
Weber. Seit unzähligen Generationen, bis zurück ins
Mittelalter als die Nachnamen entstanden, war der
Webstuhl das Arbeitsgerät der Männer gewesen. Der
jetzt vorhandene Webstuhl war nachweislich etwa 400
Jahre alt, immer wieder repariert, das konnte man
sehen. Das besagte Musterbuch wurde zu Anfang des 19.
Jahrhunderts von einem Familienmitglied von Hand aus
einem der damals gängigen Musterbücher abgezeichnet.
Es diente seither als Vorlage für die Handtücher und
Tischdecken, die im Auftrag der Bäuerinnen aus deren
Garn gewebt wurden. Die Familie besaß ein kleines
Haus, eine Kuh und etwas Ackerland, das die Frauen
bewirtschaftete, denn im Sommer mußten sich die Männer
als Maurer verdingen, weil die Webaufträge nicht für
das ganze Jahr ausreichten.
|
 |
 |
| Seite aus dem
Musterbuch des Dorfwebers Georg Weber, gezeichnet um
1800 |
Leinenhandtuch mit
Würfelköper |
Der Niedergang der Handweberei |
| Zu Beginn des
19. Jahrhunderts begannen die Schwierigkeiten für die
gewerbliche Handweberei immer mehr zu wachsen. Durch
die Auswirkungen von Napoleons Kontinentalsperre 1806
gingen für das Textilgewerbe wichtige, überseeische
Exportmärkte verloren, der Bedarf auf dem europäischen
Festland und gar im eigenen Land war nicht groß genug,
um allen ausreichend Arbeit zu geben. Nachdem die
Kontinentalsperre dann schließlich durch die gegen
Napoleon gerichtete Allianz gefallen war, bekamen die
deutschen Leinweber starke Konkurrenz aus England.
England war damals industriell bestens erschlossenen.
Dort waren seit Mitte des 18. Jahrhunderts
Spinnmaschinen und andere, arbeitssparende,
wesentliche Erfindungen gemacht worden, die eine
schnellere, billigere Produktion ermöglichten. Auch
der mechanische Webstuhl wurde in dieser Zeit in
England entwickelt, auf dem zunächst vor allem
Baumwollstoffe gewebt wurden. Ein Baumwollboom
überrollte Deutschland in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Baumwollstoffe kamen in Mode, vor allem
in den Städten.
Das bedeutete zwar nicht, daß gar keine Arbeit mehr
für die Leinweber übrigblieb, doch der Verdienst für
die Arbeit sank innerhalb weniger Jahrzehnte auf die
Hälfte herab. Dieses Dilemma traf vor allem die
Leinweber jener Gebiete hart, wo viele Menschen
ausschließlich von diesem Handwerk lebten und
vornehmlich das Verlagswesen den Markt beherrschte,
wie das zum Beispiel in Oberschlesien der Fall war.
Die ausweglose Situation der schlesischen Weber ist
bekannt, doch es gab auch andere Regionen in
Deutschland, wo die Lage prekär wurde. Zwar waren die
Leinweber in anderen Regionen, wie beispielsweise im
Schlitzerland in Hessen, nicht ganz so verelendet wie
die Schlesier, weil sie nebenher ihre kleine
Landwirtschaft bewirtschafteten wie seit alters her.
Doch auch sie verarmten völlig, nur wenige hatten die
Möglichkeit, in andere Berufe oder die aufkommende
Industrie abzuwandern, was damals ebenfalls ein hartes
Brot war.
Um die Lage der Leinweber zu verbessern,
subventionierten verschiedene Regierungen die
technische Aufrüstung der Webeinrichtungen, um
schnelleres Arbeiten ermöglichen, was zumindest für
fachlich versierten Handwerker eine Verbesserung
brachte. Doch ab Mitte des 19. Jahrhunderts war die
Entwicklung der mechanischen Webstühle so weit
fortgeschritten, daß auch Leinen darauf verwebt werden
konnte, so daß langfristig gesehen, auch diese
Aufrüstungen den Leinwebern den Wohlstand nicht mehr
zurück bringen konnte. Im Laufe der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts nahm die Zahl der selbständigen
Leinweber auch auf dem Lande immer mehr ab, die
Webzentren gingen in die mechanische Weberei über.
Nur in bäuerlichen Kreisen erhielt sich die
Leinenweberei noch bis ins 20. Jahrhundert, soweit vor
allem für den Eigenbedarf und weniger zum Verkauf
gearbeitet wurde. Die Spinn- und Webarbeit war für die
Bauern eine der Arbeiten für den Winter, wobei der
Verdienst in Geld keine so große Rolle spielte. Erst
nach dem ersten Weltkrieg ging auch diese Tradition
verloren.
|
|
Literaturauswahl:
Eduard Schoneweg, Das
Leinengewerbe, ein Beitrag zur niederdeutschen
Altertumskunde, Osnabrück 1985
Ottfried Dascher, Das Textilgewerbe in
Hessen-Kassel vom 16. Bis 19. Jahrhundert, Marburg
1968
Heinrich Hahn, Geschichte der Handweberei im
Schlitzerland, Schlitz 1978
Will Erich Peuker, Die schlesischen Weber,
Darmstadt 1971
Klaus Tidow, Die Leinenweber in und um
Neumünster, Neumünster 1976
Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 27. Band -
1987/88, Textilarbeit
Hans Michel, Die hausindustrielle Weberei
Deutschlands, Entwicklung, Lage, Zukunft, Jena
1921
|
|
|
|